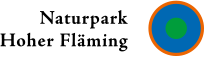Kunstwerke an der Südroute
Die Südroute
Im Januar 2009 wurde ein zweiter internationaler Wettbewerb zur Realisierung der Südroute des Kunstwanderweges ausgelobt. Künstler aus dem Fläming und aus der Region Flandern in Belgien und den Niederlanden waren aufgefordert, sich mit künstlerischen Ideen zu beteiligen. Die Wettbewerbsaufgabe beinhaltete den Bezug zur Fläminglandschaft und das 850jährige Besiedlungsjubiläum des Flämings durch Menschen aus Flandern. Jeweils sechs Künstler aus dem deutschen Fläming und aus Flandern wurden ausgewählt.
In einem dreistufigen Wettbewerbsverfahren wurden drei Preise ermittelt:
"Fünf Kuben" von Karl Menzen
"(K)uier(en) - Spazierengehen" von Silke De Bolle
"Wölfe" von Marion Burghouwt
Der Publikumspreis ging an die "Wölfe" von Marion Burghouwt
Ute Hoffritz: Kapelle
Die Idee
Die „Kapelle“ markiert durch ihre Lokalisierung im am Ortsausgang von Wiesenburg gelegenen Fabrikteich den Übergang von der Stadt zu der sie umgebenden Natur und stellt gleichzeitig eine Verbindung zwischen oben und unten und den vier Himmelsrichtungen her.
Im Übergang vom Ort in die offene Landschaft lädt sie einen Moment zur Besinnung ein, man assoziiert eine „Wüstung“, eine untergegangene menschliche Siedlung von der nur noch der Turm zu sehen ist. Da die Kapelle nicht fest im Fundament verankert ist, sondern wie eine Boje an einer Kette hängt und jeder Windstoß sie zum Tanzen bringt, kommt noch ein fröhliches, unberechenbares, spielerisches Moment hinzu.
Die Künstlerin
Ute Hoffritz (Berlin)
Studium an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg,
Studium der Bildhauerei an der Hochschule für Bildende Künste Berlin,
Meisterschülerin bei Prof. J. Schmettau,
Diverse Stipendien und Studienaufenthalte in USA, Italien, Spanien, Niederlande.
Zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen in Berlin, Amsterdam, Bilbao und San Sebastian.
Silke De Bolle: (K)uier(en) - Spazierengehen
Die Idee
Die Installation ist die Übersetzung eines Wortspiels: „Spazieren gehen“ heißt im Niederländischen „kuieren“, in dem das Wort „Uier“ (= Euter) enthalten ist. Damals wie heute sind die schwarzweiß gefleckten Kühe prägend für das Landschaftsbild in Flandern.
Die Euter sind Denkmäler für die durch die neuen Siedler eingeführten, neuen Kulturtechniken in der Landwirtschaft. Die 4 Zitzen eines jeden Euters stehen für die enge Wechselbeziehung, die die vier „Elemente“ Euter, Kuh, Natur und Mensch miteinander haben. Die unterschiedliche Euterfleckung steht für die Individualität der Menschen und der Natur.
Die Künstlerin
Silke De Bolle (Impe-Lede, Belgien)
Studium: Audiovisuelle Techniken, Video, Fotografie an der Hochschule für Wissenschaft und Kunst Narafi in Brüssel,
diverse Weiterbildungen in Aalst, Gent, Antwerpen, zahlreiche Foto- und Skulpturenausstellungen.
Marion Burghouwt: Wölfe
Die Idee
Wölfe jagen den Menschen Furcht ein, werden aber auch als die Verkörperung des unbezwungenen Geistes von ihnen geachtet. Oft gejagt und vertrieben, gelingt es den Wölfen immer wieder mit Disziplin und Ritualen, sich neue Lebensräume zu erschließen – ähnlich den Menschen allgemein, oder konkret den in den Hohen Fläming vor 850 Jahren eingewanderten Flamen.
Abseits des Weges steht eine Gruppe von drei ausgewachsenen Wölfen mit zotteligem Fell, das vom Betrachter als dicht (= stark) oder schütter (= verletzlich) gesehen werden kann. Letztere Sicht erschließt sich erst beim genaueren Hinschauen und ist auch im übertragenen Sinn so gemeint.
Die Künstlerin
Marion Burghouwt (Hamont-Achel, Belgien)
In den Niederlanden aufgewachsen, als Erwachsene Umzug nach Belgien,
Studium an der Akademie für Kunst in Neerpelt,
Experimentieren mit Materialien wie Gips, Lehm, Gras, Flachs, aber auch Acryl, Stahl und Eisen, Inspirationsquelle für die Kunstobjekte ist die Natur.
Barbara Vandecauter: Porzellanbaum
Die Idee
Vom Stamm eines realen Baumes am Standort des Porzellanbaumes wurde eine Kopie (Maßstab 1:1) aus Porzellan angefertigt, die anschließend als weißer Stamm in der Nähe des ursprünglichen Modells aufgestellt wurde.
Über die Jahre erschließt sich dem ständigen Betrachter der Installation ein interessantes Bild. Durch Wetter und Lichteinwirkung entstehen -parallel zum Original- am Porzellanbaum die gleichen farblichen und strukturellen Veränderungen (z.B. Moosbewuchs) mit dem kleinen Unterschied, dass der Porzellanbaum nicht wachsen kann, aber eine augenscheinliche Verbindung zwischen „früher“ und „heute“ herstellt.
Außerdem ist der Porzellanbaum durch den Brennvorgang geschrumpft und daher etwas kleiner als sein Original.
Die Künstlerin
Barbara Vandecauter (Antwerpen, Belgien)
Studium der Kunstgeschichte und Archäologie in Genf,
verschiedene Weiterbildungen und Kunststudium in Antwerpen und Brüssel,
Abschluss Master Fine Arts.
Diverse Ausstellungen, Skulpturen im öffentlichen Raum in Spanien, Antwerpen,
Hertogenbosch, Amsterdam, Nijmegen, Berlin–Kreuzberg.
Hannes Forster: Ruhende Brücke
Die Idee
In einer kleinen vorhandenen Mulde in der Nähe des Eisenbahnviaduktes wurde eine um 180° gedrehte Brücke installiert und somit ihrer eigentlichen Funktion, der Verbindung von Höhenzügen oder Überwindung von Tälern, entledigt.
Beim Betrachter sollen die beiden in Sichtweite zueinander stehenden Brücken Nachdenklichkeit darüber auslösen, ob für das, was wir alltäglich sehen, meinen, brauchen, nur eine Deutung möglich ist, oder auch andere Interpretationen denkbar wären. Ein auf den Kopf gestellter Funktionsbau soll verdeutlichen, dass in der Welt alles relativ ist; so ist das Kunstwerk nicht zum Betrachten, sondern auch zum „Be-greifen“ gedacht.
Das Material und die Gestaltung der umgekehrten Brücke entspricht dem Material der realen Brücke.
Der Künstler
Hannes Forster (Jamlitz, Brandenburg)
Studium an der Hochschule für Bildende Künste Berlin,
Meisterschüler bei Prof. Kaufmann,
diverse Stipendien,
Kunstpreis junger westen Recklinghausen,
Kunstpreis Berlin (Grundkreditbank).
Diverse Einzel- und Gruppenausstellungen in Deutschland, Frankreich, Ungarn, Italien, Österreich, Polen,
zahlreiche Installationen im Öffentlichen Raum.
Guy van Tendeloo: Stützen - leaning on
Die Idee
Zwei gleich schwere Elemente von jeweils 250 kg Eigengewicht stabilisieren sich gegenseitig und benötigen hierfür keine zusätzliche Befestigung.
Ein rostiges Stahlrohr von 5 m Länge ist an dieser Stelle angehoben und hält mit einem 3 cm breiten Schlitz eine ebenso breite Platte von 2 m Höhe.
Beide Elemente der Skulptur vermitteln durch ihre Massivität und Wuchtigkeit den Eindruck für sich selbst stehen zu können, was sich mit entsprechenden Untergrund auch bewerkstelligen ließe; dass sich die Stabilität der Skulptur aus sich heraus ergibt, ist gewollt und steht für die Metapher von „Gegenseitigkeit“ und „Ergänzung“.
Der Künstler
Guy van Tendeloo (Zandhoven, Belgien)
Studium Akademie van Heist, o/d Berg, Lier en Mechelen,
diverse Ausstellungen u.a. in Zoutleew, Mechelen, Lier en Antwerpen.
Karl Menzen: Fünf Kuben
Die Idee
Die Siedlungsgeschichte des Flämings wurde hier zeitlich gerafft, in einer Momentaufnahme festgehalten und visualisiert. Die fünf Kuben sollen veranschaulichen, wie sich im Verlauf von mehreren Jahrhunderten eine dicht bewohnte Region ausgedünnt hat.
Das Bild fallender Würfel erinnert in doppelter Deutung an die Vergangenheit, denn Siedlungen wurden verlassen, sind gefallen, sind wüst geworden und wir wissen auch von der Unumkehrbarkeit von Entscheidungen / Entwicklungen, wenn die Würfel gefallen sind. Die Würfel selbst sind transparent, einsehbar und lassen Raum, sich zurückzuerinnern. Assoziation: „Die Würfel sind gefallen, wir ziehen in ein anderes Land“.
Der Künstler
Karl Menzen (Berlin)
Studium der Werkzeugwissenschaften, TU-Berlin,
Ausbildung zum Bildhauer bei Volkmar Haase,
freischaffend, lebt und arbeitet in Berlin, zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen in Deutschland, Italien und Niederlande. Diverse Kunstobjekte im öffentlichen Raum, Berlin, Sachsen und Schleswig-Holstein.
Egidius Knops: Der Schwarzstorch im Fläming
Die Idee
Die Installation besteht aus 2 versetzt stehenden Reihen von Betonstelen mit einem aus buntem Glasmosaik gefertigten Motiv von drei Schwarzstörchen, die sich durch Farbe und vertikale Gliederung optisch in die Umgebung integrieren. Durch die versetzt stehenden Stelen ist das Motiv erst erkennbar, wenn der Betrachter gerade vor dem Objekt steht.
Der Schwarzstorch lebt zurückgezogen in feuchten Laubwäldern mit altem Baumbestand und ist eine besonders schützenswerte Tierart im Naturpark Hoher Fläming. Die 18 vertikalen Stelen sollen für die Schwarzstörche auch Stufen in den Wolken sein, um den schönen Fläming von oben betrachten zu können.
Der Künstler
Egidius Knops (Berlin und Niederlande)
Studium an der Kunstakademie Tilburg (NL).
Künstlerisch tätig als Maler, Bildhauer, Kunst am Bau und im öffentlichen Raum,
Studienaufenthalte und Stipendien in Paris, Italien und Amsterdam, Symposien und Ausstellungen in Heiligendamm, Flughafen Schönefeld, Leipzig, Lübbenau, Lübben, diverse bedeutende Kunstobjekte im öffentlichen Raum in den Niederlanden und Deutschland.
Jost Löber: Gartenbild
Die Idee
Mit dem Thema „Garten“ sollen die Neuerungen im Landschaftsbau und die Einführung bisher unbekannter Kulturpflanzen durch die Flamen gewürdigt werden, die bis heute für die Region prägend sind.
In der Arbeit werden zwei Elemente zu einem Bild zusammengefügt. Bildträger ist eine Stahlplatte mit Aussparungen, die – ähnlich einer Lochmaske – auf die Wiese gelegt wird, durch die die darunter liegende Vegetation sprießt und im Gartenbild die Rolle der Figur übernimmt. Die rostfarbene Stahlplatte kontrastiert mit den im Wandel der Jahreszeiten sich ändernden Farben der Botanik. Das Bild lädt ein, hineinzusteigen, darin zu verweilen und es zu erkunden.
Der Künstler
Jost Löber (Horst, Brandenburg)
Studium Malerei und Grafik an der Hochschule für Kunst und Design Burg Giebichenstein/Halle,
Freie Kunst an der Kunsthochschule Berlin-Weissensee,
freischaffender Künstler (Bildhauerei, Installation, Kunst in der Landschaft),
Gründung Künstlerkooperative: „Atelier im Grünen“.
Diverse Einzel-und Gruppenausstellungen in Deutschland und Italien,
zahlreiche Symposien und Wettbewerbe und Kunstobjekte in der Landschaft, u.a. Mohnkapseln 2004, Skulpturengarten im Schlosspark Wiesenburg.
Birgit Cauer: Flämisches Haus - eine Transplantation
Die Idee
Inspiriert vom Ölbild „Flämische Häuser“ (1892) des Malers Paul Baum (1859 – 1932) wird die architektonische Grundform dieser Häuser aufgegriffen, deren Außenwände ein Geflecht aus bunten Gartenschläuchen sind.
Das Geflecht symbolisiert die hohen handwerklichen Fertigkeiten der eingewanderten Flamen, durch die sicherer Dammbau und Kultivierung des Bodens ein gehobenes Niveau erreichten. Das im vorhandenen Baumbestand integrierte Haupthaus ist über Schläuche – symbolische Transportsysteme für Energie und Lebensflüssigkeit – mit 2 kleineren Häusern verbunden, die als „Ableger“ in den Bäumen installiert sind.
Die Künstlerin
Birgit Cauer (Berlin)
Ausbildung als Holzbildhauerin,
Studium der Kunstwissenschaften in Frankfurt am Main,
freischaffende Bildhauerin,
Lehrauftrag Plastisches Gestalten, Kunsttherapie Berlin, Weißensee,
Studienaufenthalte in Italien, Wolfenbüttel, Stipendium in Bielefeld.
Diverse Symposien in Deutschland und Polen,
Einzel- und Gruppenausstellungen in Darmstadt, Berlin, Bielefeld, München, Potsdam, Wolfenbüttel, Kassel,
Teilnahme an der Aquamediale im Spreewald.
Marie-Christine Blomme: Sphären
Die Idee
Die Installation möchte Stimmungen, Wirkungsweisen und Einflüsse, die Natur bei Menschen hinterlässt, einfangen und festhalten.
Die scheinbar spontan zueinander in Beziehung gesetzten Kugeln unterschiedlicher Durchmesser haben einen festgelegten Abstand zueinander und gruppieren sich in der Nähe eines Baumes.
Der Größe nach sortiert, spiegeln sich in den Oberflächen der Kugeln folgende, der Natur entnommene Motive wieder: ein Löwenzahn („Pusteblume“) in der größten Kugel, in der 2. die Spuren eines kleinen Tierchens im Schnee und in der 3. die Kontur einer Rosenknospe.
Die Künstlerin
Marie-Christine Blomme (Sint-Truiden, Belgien)
Studium der Biotechnik und Design-Studium an der Kunstschule in Genk,
Workshops, Illustration von Büchern,
Unterrichtet in der Akademie Haspengouw Zeichnen für Kinder,
Tätigkeit: Grafikerin.